





Anekdotische Landschaften
Kurz nach dem Stein kommt der Pflasterstein. Mauern und Felsen und Hallen. Künstliche Gebüsche, und dann Ruderalgewächs über menschengemachten Fußböden. Das Erzählende im Bild und das Bildliche im Text – nicht nur metaphorisch aufeinander bezogen, sondern als etwas Drittes einen Zustand ausleuchtend: „Anekdotische Landschaften“ lassen das Sprechen und das Sehen im Überblick münden, als leicht erhöhtes Schauen über Gelände.
Erzählen stellt gemeinsame Wissenshorizonte her – und damit Kategorisierungen des Vorgefundenen, eine Ordnung in einer per se chaotischen Welt. Romys Landschaften sind von menschlichem Tun durchwirkt und durchbrochen – Anwesenheit, wo die Körper in den Bildern selbst verschwunden sind. Das Anekdotische wehrt sich gegen das von vornherein Nützliche und nimmt Umwege. Unnötig, in allem sofort Sinn zu finden. Ideal ist ein Überhang – eine Freiheit im Denken.
Marcel Raabe

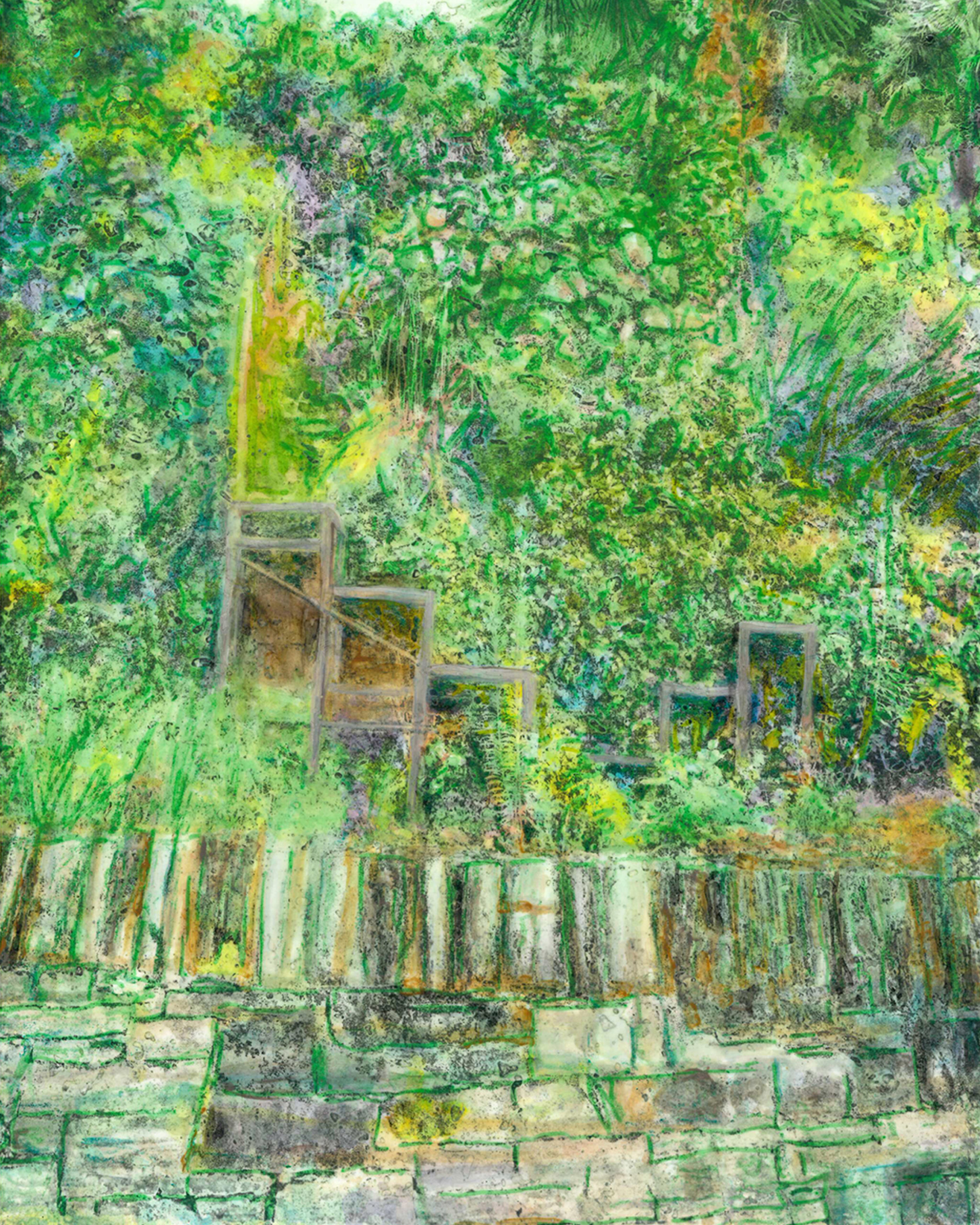
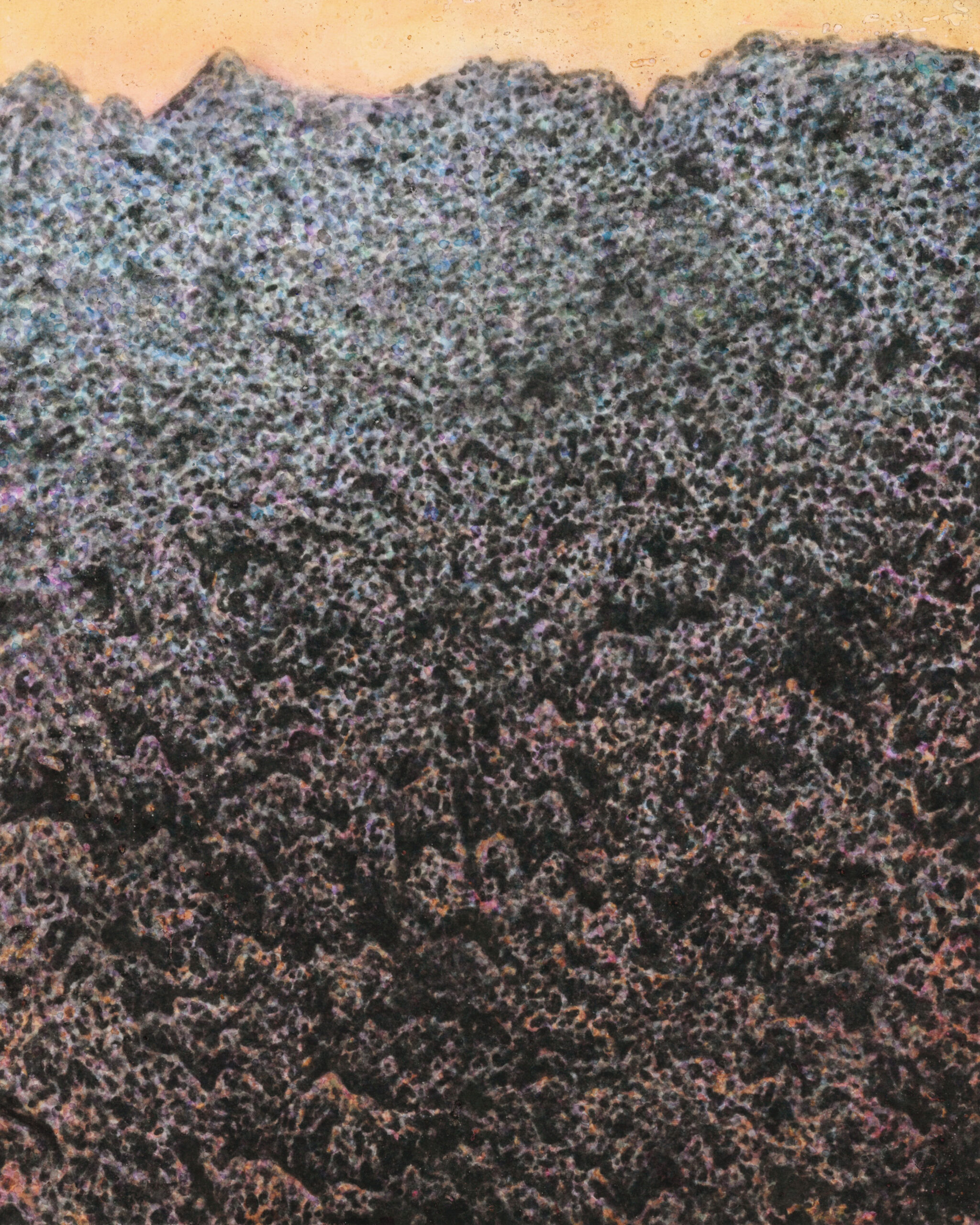
Auf der Via Vairano laufen kaum Menschen.
Ich bin ein Alien, um den die Autos selbstvergessen
und überrascht herumfahren. Sie
bemerken hier nichts außer mich. Ich beginne,
auf das Schild zu achten: Sentiero. Eigentlich
sind das keine Pfade. Eher ein die Straße
kreuzendes System aus Treppenaufgängen.
Ich habe eine Pflanze gesehen, größer als
das Haus daneben – kein Baum, eher ein
Strauch. Alles wuchert. Die Bauten, die Pflanzen
verschmieren ineinander. Sie teilen auf
den Treppen einen engen Raum. Glitschiger
Stein, abgelatschte Stufen werden zu Rutschpartien.
Hinterm Zaun der ein oder andere
Aufzug mit griechisch-antikem Eingang, oder
auch ein Senioren-Treppenlift, der aussieht,
als wäre er aus den Siebzigern. Betonierte
Holzpfähle reißen schon wieder aus und stehen
da wie locker gewordene Zähne, denen
das Zahnfleisch abhandengekommen ist.
Und Zähne zeigen auch die Gesichter hinter
Drahtzäunen – die sind auf runde Steine gemalt,
glotzen einen an und lächeln über einen
beim Aufstieg. Ich atme flach, stemme die
Arme in die Beine, bekomme meinen Rücken
nicht mehr gerade. Wozu sich bewegen,
wenn man auch ein Stein sein kann.
Die Felsen hier sehen aus wie Flocken aufgegangenen
Blätterteigs. Oder wie eine seltsame
Variante des 3D – ich kann es nicht genau
sagen. Als ob zwei Seiten nicht zu ihrer kompletten
Plastizität gekommen wären. Wie etwas,
das nur halb existiert. Wie Kirchenreliefe
aus dem Mittelalter, die nur zum Betrachter
hin ausgearbeitet sind. Giovanni di Paolo: Es
erklärt sich für mich schon ganz gut, warum
es teilweise so bizarre Bergformen in seinen
Bildern gibt, oder zumindest könnte man denken
– auch wenn er ein recht eigenwilliger
Maler ist – ob diese Formen nicht doch echt
gut getroffen sind.
Romy Julia Kroppe


Erster Badetag. Ein verlorenes Teil ist wie
Pfand vom Leben für den Tod. Ich sitze schief
auf dem Stein. Es ist ein guter Platz. Der muss
es jetzt sein. Der erste Ort war zu felsig, zu
voll, zu sonnig. Der zweite war auch nicht
okay. – Sonniger als der Erste? – Zu viel Beton.
Nun Nr. 3. Der Schirm steht so, dass er
die Hälfte des ihn stützenden Steins beschattet.
Den Restschatten teilen wir uns dann.
Bewegen darf ich mich nicht. Anspannung
oder Entspannung und Hitzetod.
Er schaut rüber auf die andere Seite der
Bucht und kneift die Augen zusammen. Da ist
doch Schatten. – Wo denn bitteschön, und
überhaupt: Schon oder noch? – Doch, da
unter dem Vorsprung. Es ist gut, einfach loszulassen.
Wir suchen einen neuen Platz. Der
Schatten stellt sich als zu klein heraus und wir
liegen mit dem Kopf in Kippen, aber jetzt ist
endlich Schluss. Vor mir das Meer – träges
fettes Salzwasser, Tauben und Menschen.
Hitze und Stille. Da ist noch ein allgemeines
Brummen: ein Stimmensound, der sich zu
einem Klumpen formt, ultrahocherhitzt und
nicht mehr trennbar ist.
Links neben uns, da wo der Schatten des
Hausfundaments hinführt, ist in einer Ecke
unter dem Restaurant ein Steinabsatz. Im
Gegensatz zu allen Plätzen drumherum ist er
eine Durchgangsstation – für sie eine Haltestelle.
Sie setzt sich. Bald gesellt sich ein Typ
zu ihr. Sie reden, keifen sich an und gestikulieren
– Es wird zu viel. Er zögert, aber geht
dann doch. Sie weint. Sitzt. Kein Mucks mehr
von ihr, aber die Tränen fließen weiter, als
wäre sie der erste Mensch. Allein.
Er hat meinen Blick bemerkt und sagt: Ja,
die weinende Piratenbraut, und zitiert Funny
van Dannen: Wenn das so weitergeht, wird’s
doch noch ein neuer Ozean. Ich stelle mir
vor, wie das Wasser steigt und keiner von
uns mehr aus der Bucht rauskommt. Nur
sie sitzt noch oben auf dem Vorsprung. Wir
schreien sie an. So schlimm ist das doch alles
nicht! Sie soll mal lieber schnell aufhören,
sonst ertrinken wir alle! Davon muss sie nur
noch mehr weinen. Es tut ihr so leid, aber
aufhören kann sie nun nicht mehr. Das Wasser
zieht alles mit sich: die Schirme, Strandmatten,
Pizzapackungen, Smartphones, Bücher,
Sonnenbrillen. Schreie. Dann ist wieder
Ruhe. Das Wasser wird still. Die Oberfläche
glättet sich und die Luft ist leer – nur die Poolnudeln
und bunten Tiere schwimmen oben.
Die Sonne scheint noch immer. Die Tränen
sind vertrocknet. Sie geht.
Etwas später taucht am selben Platz eine
weitere Frau auf. Sie wirkt von Anfang an
irgendwie fahrig. Sie legt ihr Tuch aus. Die
Familie neben uns geht. Auf dem Weg zum
Pier laufen sie an ihr vorbei, und sie fängt an,
durchzudrehen. Sie ist aufgeregt und zeigt
auf das Kind der Familie – die Familie versteht
sie, ich meine sprachlich, inhaltlich bezweifle
ich das. Sie zeigt wieder auf das Kind, redet
und weint. Sie geht dann und setzt sich vorne
in das warme brackige Wasser. Sie wiegt
ihren Oberkörper vor und zurück, schippt
Wasser auf ihre ausgestreckten Beine und
weint immer noch.
Eine Dopplung. Ungenaue Wiederholung.
Ein blöder Witz vom Universum. Hab ich was
gelernt, erfahren? Weiß ich jetzt irgendwas?
Ich muss wieder an die Braut denken, an das
ozeanische Gefühl, und dass sich Töne wider
erwarten unter Wasser ganz anders und viel
intensiver anhören als darüber. Dass vorne
viele Kinder sind und das Wasser wahrscheinlich
vollgepisst ist. Dass die Steine rutschig
sind und ich Angst habe unter Wasser, weil
ich, wenn ich muss, nicht die Luft anhalten
kann.









