
Letter
»Wenn ich ein Wort gebrauche«, sagte Goggelmoggel in recht hochmütigem Ton, »dann heißt es genau, was ich für richtig halte – nicht mehr und nicht weniger.« »Es fragt sich nur«, sagte Alice, »ob man Wörter einfach etwas anderes heißen lassen kann.« »Es fragt sich nur«, sagte Goggelmoggel, »wer der Stärkere ist, weiter nichts.«1
Sprache als Ding — von Maik Schlüter
Sprache ist eine Konstruktion und ein Werkzeug der Kommunikation. Sie basiert auf komplexen und komplizierten Regelwerken. Und obwohl sie niemals ein Ding selbst darstellt, sondern ausschließlich als Verweis auf etwas existiert, behauptet Sprache sich als alles beschreibende Macht. Wer besitzt die Deutungshoheit über die Worte? Der Mensch wortet die Welt und bedeckt die Vielzahl an Phänomenen, Dingen und Figuren mit Beschreibungen und Begriffen. Das Geheimnis der Sprache liegt in ihrer Doppeldeutigkeit: Sie ist gleichermaßen ein System von unterscheidbaren Lauten und eine systematische Anordnung von Zeichen. Die Laute transportieren den Inhalt. Die Verwendung von wohlgeformten Sätzen und einer verbindlichen Grammatik ist möglicherweise eine anthropologische Eigenheit. Nur der Mensch bringt Sprache und Geist so vollendet zum Ausdruck. Anders als die Tiere, können Menschen immer auf etwas verweisen, das außerhalb ihrer selbst liegt. Aber wie entsteht Sprache? Ist sie ein Organismus, der wächst, sich entwickelt und verändert, um schließlich zu altern und zu verschwinden? Oder ist die Sprache ein geschlossenes und bereits bestehendes System, das gemäß der Regeln der Grammatik, Syntax und Semantik erlernt werden muss? Ein Gebilde, das in einen vordringt, ein Raum, in den man geworfen wird und in dem man erbarmungslos den Diktaten von Laut und Bedeutung, Sinn und Struktur folgen muss? Oder ist Sprache ein Virus aus dem Weltall, wie es William S. Burroughs einst behauptete? Was passiert, wenn wir die Sprache nicht richtig lernen, wenn wir uns ihrer Konventionen und Systematik verweigern oder unsere Sprache verlieren? Dann fallen wir heraus aus dem Schema von Senden und Empfangen, von Verstehen, Erklären, Interpretieren und Bewerten. Dann stellt sich die Frage, wer der Stärkere ist, was gesprochen werden darf und welche Bedeutung damit konstituiert wird.
»Letter« (2015) heißt eine Arbeit von Anna Vovan. Schon der Titel ist doppeldeutig, denn das Wort Letter steht im Englischen sowohl für den einzelnen Buchstaben als auch für den Brief. Die Arbeit besteht aus 135 A4-Blättern, auf denen aber weder Buchstaben noch Worte zu erkennen sind. Schwarze Formen, die abstrakt und amorph erscheinen, sind auf hochformatigen Blättern im oberen Drittel platziert. Die Formen erinnern mal an fette schwarze Wülste, dann an die Umrisse einer Sprechblase oder die äußeren Linien eines Graffitis. Die Formen lassen aber auch einen Vergleich mit Schwärzungen zu, die in zensierten Texten oder Textteilen zu finden sind. Die Anordnung als Tableau gibt der Präsentation eine systematische Strenge und Ordnung, die wie die Logik einer alphabetischen Typenleiter aussieht.
Alle Versuche in der Arbeit ein Schriftbild oder einen lesbaren Text zu erkennen scheitern. »Letter« bietet weder Worte noch Sätze, auch keine lautmalerischen Zeichen oder irgendeine andere Form von systematischer Semiotik an. Die schwarzen Formen sind wie blinde Flecken in der Logik des Sprechens und Schreibens. Dennoch basieren sie explizit auf Schrift und tragen in sich den gesamten Inhalt eines Briefes. Denn die Worte der handschriftlichen Aufzeichnung ihres Großvaters hat Anna Vovan so weit vergrößert, dass Strukturen und Relationen des Schriftbildes so monströs werden, dass sie letztlich unleserlich sind. Was wurde gesagt und mit welcher Intention? Wer ist der Adressat? Was geschieht, wenn ich einen Brief lese, der nicht an mich gerichtet war? Welche Gefühle und Schlüsse ziehe ich aus dem Geschriebenen? An welchem Punkt in der Zeit befinde ich mich? Projiziere ich in die Zukunft, beziehe ich mich auf die Gegenwart oder versuche ich mich an einer historischen Rekonstruktion? Beim Betrachten von Vovans Arbeit erfahren wir darüber nichts, sondern sind ausgeschlossen aus dem System einer wie auch immer gearteten Mitteilung. Aus der Schrift wird hier ein abstraktes Bild, aus einer Erzählung werden visuelle Segmente.
»Letter« bringt auf dieser Ebene ein tiefes Misstrauen gegenüber der Sprache zum Ausdruck. Vielleicht war der Brief ohnehin unleserlich oder ungenügend im Sinne einer adäquaten Aussage? Vielleicht war der Inhalt aber auch so berührend und verstörend, dass gerade deshalb sein Inhalt verzerrt bzw. visuell interpretiert werden musste? Sprache und Schrift werden in Anna Vovans Arbeit mit ihren eigenen Mittel konterkariert. Denn der Ausgangspunkt ist die Schrift selbst. Sie übermalt und zensiert nicht im Sinne einer Schwärzung, vielmehr erscheint die Visualisierung wie ein Vordringen in den Inhalt und den Prozess der Wortfindung. Ein Vorstoß in die physische Existenz von Sinn und Bedeutung. Die Sprache wird in Anna Vovans Arbeit zu einem undefinierbaren Ding.
In »V. Woolf (28.03.1941)« von 2015 zeigen sich die Grenzen der Sprache, aber auch die Hilflosigkeit und die Verzweiflung, die mit einem Verlust der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten einhergehen. Virginia Woolfs Abschiedsbrief, den sie kurz vor ihrem Suizid an ihren Mann schrieb, ist ein berührendes Dokument der Angst, der Einsamkeit, der Krankheit und der Erkenntnis, nichts mehr sagen zu können. Anna Vovan reduziert die ohnehin schon knappen Aussagen auf die Personalpronomen. Dazwischen liegt scheinbar die Welt, die aber nur dann Sinn macht, wenn sie in einer Beziehung gespiegelt wird. Ganz gleich ob es sich um reale Erfahrungen, um Sinnlichkeit, um Liebe oder Formen der Imagination handelt (tatsächlich sind die Grenzen fließend), bedeutet die durch Depression und Wahn verursachte Sprachlosigkeit einen existenziellen Verlust der Verbindung zum geliebten Menschen und zur Welt.
Dieser Zusammenhang findet sich auch in den Filmbildern mit den Titeln wie »It we« oder »I you me« oder »I her« (2015). Hier aber nicht in einem authentischen Bekenntnis, wie dem der Dichterin Virginia Woolf, sondern vielmehr in dem nie abreißenden Strom an Bildern, Worten und Geschichten, wie sie die Filmindustrie unaufhörlich produziert. Anna Vovan generiert aus Filmsequenzen einzelne Bilder und legt diese in einem Sandwichverfahren übereinander. Es sind aber nicht die Bilder, die ihre Auswahl leiten, sondern eingeblendete Untertitel, die synchron zum gesprochenen Text, Worte und Handlungen lesbar werden lassen. Vovans Interesse gilt auch hier ausschließlich den Personalpronomen. Jeder Satz und jeder Dialog wird mit diesem Vorgehen reduziert auf einen Aspekt von Beziehung, Kontaktnahme, Ansprache oder Zuschreibung. Wie viele Filme gibt es zum Thema Ich und Du? Gibt es überhaupt andere Themen? Und worum geht es? Um Liebe, Hass, Eifersucht, Angst, Sex, Macht, Lüge, Verrat, Glück, Unterwerfung? Die Geschichte wird dem Film entzogen. Übrig bleibt eine existenzielle Reduktion auf verbale menschliche Interaktion. Aber in der Endlichkeit der Themen und Worte liegt eine Unendlichkeit der Bedeutung und Kombinatorik begründet. Selbst dann, wenn immer das Gleiche gesagt wird.
Die Abwesenheit von Worten ist in der Arbeit »Gap« (2015) zu sehen. Aber stimmt das? Kann man Abwesenheit überhaupt sehen? Und geht es in »Gap« nicht vielmehr um das Hören. Hören kann man bekanntlich nicht sehen, aber jenseits der Sichtbarkeit sind Worte, Töne, Geräusche immer wahrnehmbar. Im Gegensatz zum Auge lässt sich das Ohr nicht schließen. Oftmals ist man gezwungen Dinge zu hören, die man nicht hören möchte. Aber man kann genauso gut seinen Hörsinn auch darauf ausrichten, etwas zu hören, was man nicht hören soll. Sprechen und Gehörtwerden sind fundamental verkoppelt. Worte, die keinen Adressaten oder Zuhörer finden, führen früher oder später in die Isolation oder sogar in den Wahnsinn. Anna Vovans Arbeit »Gap« zeigt unter einer Hälfte der Tür hindurch geschobene Fotopapiere, die im Raum und mit dem vorhandenen Licht belichtet wurden. Der Spalt ist der Riss im Gefüge der Kommunikation: Barriere und Öffnung zugleich. Eine Möglichkeit trotz der Grenzen miteinander zu sprechen. Eine unter der Tür hindurch geschobene Nachricht kann auch ein Brief sein, eine Bitte, ein Hilferuf, ein Komplott, ein Wort gegen die Isolation, eine Möglichkeit, die Monade der Subjek- tivität zu überbrücken. In »Gap« geht es vielleicht um erzwungene Stille oder um zugeschlagene Türen? Um ein Zuviel und ein Zuwenig an Worten? Die Abstraktion des Bildes stellt in »Gap« die Worte in Frage, nicht aber den Akt der Kommunikation.
Maik Schlüter




Fotogramm
30,2×24 cm

Fotogramm
30,2×24 cm

Fotogramm
30,2×24 cm

Fotogramm
30,2×24 cm

Fotogramm
30,2×24 cm

Fotogramm
30,2×24 cm

135 Pigmentprints
je 29,7×21 cm

Pigmentprint
29,7×21 cm

Pigmentprint
29,7×21 cm

Digitaler C-Print
80×142 cm
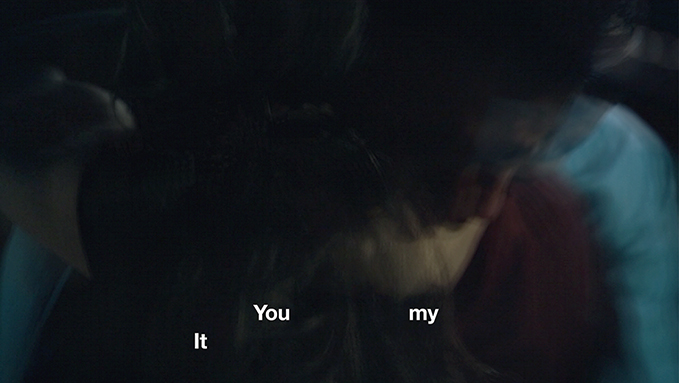
Digitaler C-Print
80 × 142 cm

Schreibmaschine auf Papier
29,7×21 cm

Digitaler C-Print
80×142 cm